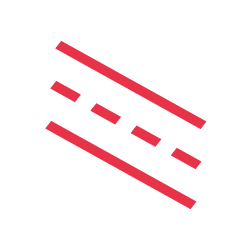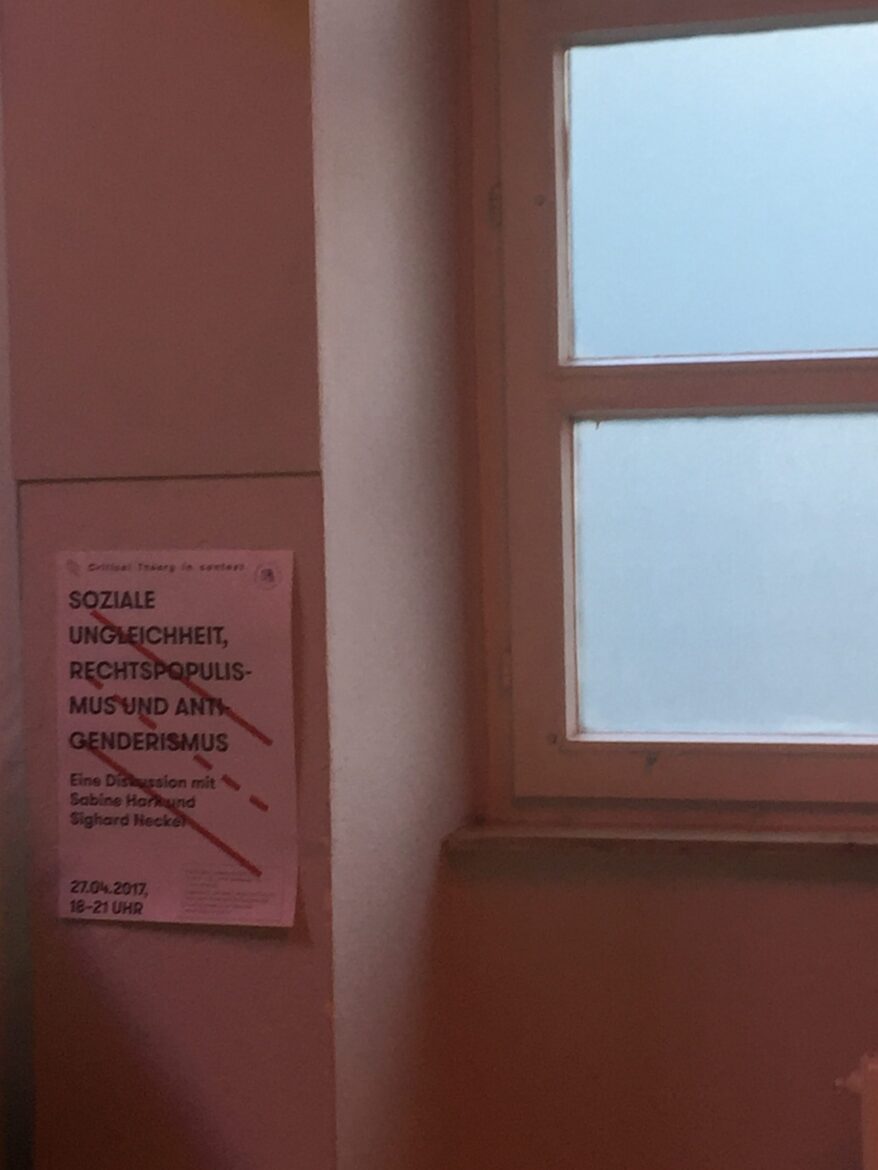Im Rahmen der Reihe „Critical Theory in Context“ haben Sabine Hark, Professorin an der TU Berlin, sowie Leiterin des Zentrums für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung und Sighard Neckel, Professor für Gesellschaftsanalyse und Sozialer Wandel an der Universität Hamburg, am 27. April das Thema „Soziale Ungleichheit, Rechtspopulismus und Anti-Genderismus“ in der Vierten Welt mit vielen Interessierten diskutiert.
Das Folgende ist ein kurzer Nachbericht dieser Diskussion:
1. Krisendiagnose gegenwärtiger Entwicklungen und die politischen Reaktionen
Schon in der Diskussion mit Oliver Nachtwey über „Die Abstiegsgesellschaft“ wurde angeführt, dass sich gegenwärtig die Gestalt sozialer Ungleichheit wesentlich verändert und verschärft habe. Auch Sighard Neckels Arbeiten zeigen auf, wie sich die Sozialstruktur auf eine neue Weise polarisiert. Am unteren Ende der gesellschaftlichen Hierarchie münde dies in Pauperisierung und Entrechtlichung, am anderen Ende mache sich die Bevorteilung der oberen Schichten und vermögenden Klassen bemerkbar. Ebenfalls seien wir mit Prekarisierungstendenzen in Hinblick auf die Sicherung der Lebensführung konfrontiert, die vor allem mit einem fundamentalen Wandel der Arbeitswelt einhergingen. Schließlich ließen sich im gegenwärtigen Prozess soziale Schließungseffekte und damit ein Ende des individuellen Aufstiegs und sozialer Mobilität innerhalb der Gesellschaft beobachten.
Diese Krisentendenzen haben zu einer Verschärfung der politischen Lage geführt. Vor allem populistische Stimmen wurden auf den Plan gerufen und konnten sich mit der Anrufung identitärer, völkischer Ideologien immer mehr Gehör verschaffen. Diesen rechten Bewegungen, die sich als „Schutzmacht“ in ökonomischer und kultureller Hinsicht gerieren, ist es gelungen, die soziale Frage zu besetzen und gewissermaßen umzuschreiben: Der Verteilungskonflikt zwischen „oben“ und „unten“ wurde in einen Verteilungskampf zwischen „innen“ und „außen“ verwandelt, die Frage der sozialen Sicherheit in das Thema öffentlicher Sicherheit und deren Gefährdungen durch ein „Außen“ überführt. So ließe sich sagen, dass diese Umschreibungen die soziale Frage eher blockieren, als dass sie diese neu adressieren würden.
Demgegenüber erfahren linke Parteien und Bewegungen gegenwärtig eine zum bestimmten Anteil selbst- oder mitverschuldete Krise. Nicht nur haben sie eine neoliberale Politik gebilligt und übernommen, mit ihrem vorrangigen Engagement für Identitäts- und Antidiskriminierungspolitik, so ein verbreiteter Vorwurf, wurden kapitalismuskritische Themen des sozialen Zwangs und der Klassenfrage vernachlässigt. Ebenso wurde unterschätzt, dass kulturelle Liberalisierungen auch für den (legitimatorischen) Fortbestand des Kapitalismus dienlich waren.
2. Zum Verhältnis wirtschaftlicher und kultureller Liberalisierungsprozesse
In der Debatte um (feministische) Emanzipationsbewegungen und die „neue“, neoliberale Form des Kapitalismus wird in den letzten Jahren unter anderem die These einer gegenseitigen Koalition oder Komplizenschaft vertreten. Emanzipative Kämpfe – wie etwa auf dem Feld der Gleichstellungspolitik und Antidiskriminierung – hätten zu einer wirtschaftlichen Liberalisierung bzw. Marktradikalisierung beigetragen, wie andersherum die Emanzipationszuwächse feministischer Bewegungen nur durch und in Allianzen mit neoliberalen Wirtschaftsimperativen erreicht würden. Als ein Beleg hierfür wird üblicherweise der Umstand herangezogen, dass zuvor ausgegrenzte Akteure selbst zu Profiteuren der sozialen Veränderungen werden, etwa indem sich Frauen als erfolgreiche Marktsubjekte emanzipieren. Dieser „Allianz-These“ ist aus unterschiedlichen Gründen kritisch zu begegnen.
Zunächst einmal insoweit, als sie impliziert, dass zwischen wirtschaftlichen und kulturellen Liberalisierungsprozessen ein kausales Bedingungsverhältnis bestehe. Mit dieser Betrachtungsweise ist es aber nur allzu leicht, emanzipative Bewegungen zu„Sündenböcken“ für die mit der Neoliberalisierung einhergehenden Krisenerscheinungen zu machen. Ebenso verstärkt diese Annahme das Bild des „Nullsummenspiels der Gleichheiten“; das Bild also, dass es ein „Mehr“ an kultureller Gleichheit nur auf Kosten eines „Weniger“ an ökonomischer Gleichheit geben könnte. Beide dieser Annahmen sind weder in theoretischer noch in praktischer/empirischer Hinsicht fundiert. Auch ist nicht klar, ob sich diese beiden Ebenen analytisch so einfach trennen und gegenüberstellen lassen.
Ein möglicher Weg, diese These zu korrigieren, bietet sich mit einer alternativen Beschreibung der angesprochenen Entwicklungsprozesse. Liberalisierungen auf der kulturellen und wirtschaftlichen Ebene können als parallele Entwicklungsprozesse beschrieben werden, auf deren unterschiedliche Stränge der Kapitalismus jeweils angewiesen ist. Eine Kritik an diesen Entwicklungsprozessen sollte daher aus kapitalismus- und nicht emanzipationskritischer Perspektive erfolgen.
Dennoch bleibt zu fragen, ob die Beschreibung der kulturellen und wirtschaftlichen Liberalisierungsprozesse als „parallele“ Entwicklungen, die der Kapitalismus für seinen Erhalt bedarf, nicht eine noch zu schwache Kritik an der oben genannten „Allianz-These“ darstellt. Denn auch diese letztlich funktionale Erklärung beruht noch auf dem Bild der sich als erfolgreiches Marktsubjekt integrierenden Frau. Dass Frauen sich in den letzten Jahrzehnten nicht anders als über den Eintritt in den Arbeitsmarkt, nur als Marktsubjekte emanzipieren konnten, wird dann zu wenig kritisch reflektiert. Zudem, so zeigt Sabine Harks Analyse auf, besteht eine grundlegende Ironie dieses emanzipatorischen Teilerfolgs darin, dass just in dem Moment, in dem Frauen breitere Karrierewege offen stehen, „Erfolg“ als leistungsbezogene Kategorie durch neoliberale Dynamiken vollständig entwertet wurde. Eine stärkere Kritik an der „Allianz-These“ beschreibt diese Entwicklungen daher nicht als „parallel“, sondern als ungleichzeitige Entwicklungen, die strukturelle Probleme offenlegen, die vorher schon bestanden.
3. Emanzipative Bewegungen als Indikatoren für tieferliegende strukturelle Probleme
Durch die Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt ist es zu einer Verschiebung der Machtverhältnisse/-balancen innerhalb der Arbeitsorganisation gekommen. Frauen sind nicht mehr gewillt (ausschließlich) die unbezahlte Reproduktionsarbeit zu leisten und die Frage der Organisation dieser Arbeit lässt sich nicht mehr über die Geschlechterordnung lösen. Diese war lange Zeit funktional für die Organisation dieser Arbeit. Dass dieses Ordnungsmodell in funktionaler Hinsicht ins Wanken geraten ist impliziert jedoch nicht, dass dieses ideologisch nicht fortwirkt.
Die neoliberale Antwort auf diese zumindest in materieller Hinsicht veränderten Verhältnisse ist die Kommodifizierung der Tätigkeiten der vormals unbezahlten Reproduktionsarbeit. Die verheerendsten Folgen dieses Kommodifizierungsprozesses zeigen sich heute in den sogenannten „global-care-chains“, an deren unteren Ende Frauen stehen, die ihre ärmeren Herkunftsländer und Familien verlassen, um in wohlhabenderen Ländern die Reproduktionsarbeit zu leisten. Diese Frauen arbeiten oftmals in Verhältnissen, die alle modernen (Rechts-)Standards entbehren und neofeudale Herrschaftsabhängigkeiten etablieren. Hieran lässt sich die Frage anschließen, ob diese Entwicklungsprozesse grundlegendere Dichotomien von bezahlter Erwerbsarbeit und unbezahlter Reproduktionsarbeit bzw. freier und unfreier Arbeit aufzeigen, auf die der Kapitalismus funktional angewiesen sein könnte und Kommodifizierungsprozesse daher immer nur in begrenztem Ausmaß eine Antwort sein können. Diese Frage gilt es weiter zu diskutieren.
Was diese Entwicklungsprozesse klar verdeutlichen, ist, dass jede politische Agenda, die sich als emanzipatorisches Projekt versteht/geriert – egal, ob sie sich dabei als feministisches Projekt ausweist oder nicht – das Thema der Rechtsgleichheit in Bezug auf globale Geschlechter- und Klassenwidersprüche neu adressieren muss. Das Phänomen des Anti-Genderismus verhindert genau das.
4. Anti-Genderismus
Anti-Genderismus ist vornehmlich der Versuch, auf Feldern von Geschlecht und Sexualität rechte Hegemonie und völkisch-familialistische Politik zu etablieren. Rechte Kulturkämpfe haben sich historisch häufig auf diesen Feldern abgespielt, da diese unmittelbar an den Alltagsverstand und das Alltagsleben der Menschen anknüpfen und sich besonders gut als „dämonisierende Projektionsflächen“ sowie zur Etablierung eines Wir-Sie-Gegensatzes eignen. Genau an dieser Stelle, in dem Erzeugen gemeinsamer Feindbilder, ist diesem Phänomen äußerst kritisch zu begegnen und gilt es dieses in seinen womöglich ideologischen Dimensionen zu hinterfragen. Zu einer weitergehenden Auseinandersetzung mit diesem Thema findet sich hier ein Beitrag von Eva von Redecker. Das Folgende ist eine Zusammenfassung und follow-up dieses Beitrags: von Redecker_Vier Thesen
Verfasst von Eva von Redecker, Isette Schuhmacher und Lea Prix
Diese Ausgabe der Texte zur Kunst hat zu diesem Thema ein Gespräch zwischen Sabine Hark und Sighard Neckel veröffentlicht.