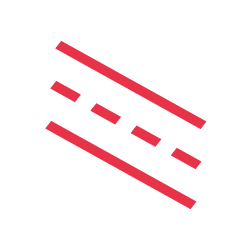Über Sozialismus reden #3
Enteignen und dann?
Mit Sabine Nuss und Hans-Jürgen Urban (Moderation: Christian Schmidt). Im Anschluss an die Podiumsdiskussion können Teilnehmende Fragen stellen.
0:00:00 Einleitung
0:02:59 Vorstellung der Gäste
0:05:46 Was und warum enteignen?
0:16:57 Welchen Stellenwert haben Enteignungen?
0:26:45 Was bedeutet enteignen genau?
0:32:57 Was sind die Ziele von Enteignung?
0:39:55 Welche Machtverhältnisse entstehen durch Enteignungen?
0:44:25 Wer entscheidet nach der Tyrannei der Eigentümer?
Je größer die Verwerfungen auf dem Wohnungsmarkt, je größer überhaupt die ökologischen und sozialen Krisen werden, die die freie Marktwirtschaft produziert, umso lauter werden auch die Stimmen, die nach radikalen Lösungen rufen. Mit der Berliner Kampagne „Deutsche Wohnen & Co enteignen“, aber auch mit den Forderungen nach einer „Sozialisierung“ von BMW und ganz generell Unternehmen, deren Geschäftsmodell auf der Förderung und Verbrennung von fossilen Energieträgern beruht, ist die Enteignung von privatem Kapital wieder in die politische Diskussion zurückgekehrt. Doch was bedeutet „enteignen“ eigentlich genau? Verstaatlichung, Rekommunalisierung, Überführung in gemeinschaftliches oder genossenschaftliches Eigentum sind hier gängige Antworten. Und nach den Erfahrungen mit der Planwirtschaft des „realexistierenden“ Sozialismus wird regelmäßig hinzugefügt, dass es natürlich um die demokratische Bewertung von Bedürfnissen und kollektive Entscheidungsformen gehe. Wie diese genau aussehen und ob sie einen Sozialismus zur Voraussetzung haben oder sich auch im Kapitalismus verwirklichen lassen, ist das Thema des dritten Gesprächs in der Reihe Über Sozialismus reden, das zugleich an den Eigentums-Workshop im Dezember 2018 sowie das Barrikadengespräch zur Wohnungsfrage (mit Canan Bayram, Jenny Weyel und Daniel Loick) anknüpft.
Sabine Nuss ist die Geschäftsführerin des Karl Dietz Verlags in Berlin. In ihrem Buch Keine Enteignung ist auch keine Lösung (Dietz Berlin 2019) plädiert sie für kleine und große Wiederaneignungen der gesellschaftlichen Produktion.
Hans-Jürgen Urban ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall und Permanent Fellow am Jenaer Kolleg Postwachstumsgesellschaften. Er plädiert dafür, wirtschaftliche Entscheidungen schrittweise zu demokratisieren und die Zivilgesellschaft in sie einzubeziehen.
Highlights aus der Diskussion
00:09 Welche konkrete rechtliche Form soll die Gemeinwirtschaft annehmen?
01:24 Wie lassen sich gesellschaftliche Mehrheiten für Enteignungen finden?
05:33 Braucht es nicht eine Unterstützung von „Deutsche Wohnen & Co enteignen durch die Gewerkschaften?
09:07 Braucht es einen Systembruch?
13:59 Wie tief reicht das neoliberale Denken?
15:09 Ist also das Eigentum in dem Sinne toxisch, dass es den Weg zur Befreiung verbaut?
17:32 Müssen nicht jetzt unumkehrbare Entscheidungen getroffen werde, um die Welt zu retten?
Bericht und Kommentar zur Onlinediskussion „Enteignen und dann“
von Isette Schuhmacher
Vergesellschaftung und der Weg zu ihr
- Von der Enteignung zur Vergesellschaftung
Der Begriff Enteignung ist wieder vermehrt im öffentlich-politischen Diskurs vertreten und richtet sich auf ganz unterschiedliche soziale Bereiche: Forderungen nach der Enteignung von privatem Kapital zielen auf den Zugang zu grundlegenden Gütern wie Strom, Wasser, Bildung, Wissen und Gesundheit (letzteres lässt sich jüngst in der Debatte über Impfstoffe und das Aussetzen von Patentrechten beobachten). Andere Forderungen wiederum thematisieren die Möglichkeit der Enteignung von Schlüsselsektoren wie die Stahl-, Automobil- und Rüstungsindustrie, und seit der Finanzkrise auch verstärkt die Enteignung von Banken. Ein weiteres aktuelles Beispiel findet sich im Bereich Wohnen initiiert durch die Berliner Kampagne Deutsche Wohnen & Co enteignen. So unterschiedlich diese Enteignungsforderungen sind, drei Dinge haben sie allesamt gemeinsam:
Zum einen bezwecken sie nicht, den Einzelnen ihr persönliches Eigentum zu entziehen oder gar „wegzunehmen“ – eine Assoziation, die viele fast schon reflexhaft mit der Enteignungsdebatte verbinden. Die private Verfügung über Konsumtionsmittel steht außer Frage. Es geht vielmehr um das Eigentum an Produktionsmitteln und Gütern der Daseinsvorsorge.
Zweitens reagieren die unterschiedlichen Enteignungsforderungen auf die Defizite und Fehlleistungen einer auf dem Privateigentum beruhenden kapitalistischen Ökonomie, die in einigen Bereichen besonders gravierend zutage treten.
Und drittens wird Enteignung nicht um der Enteignung willen angestrebt, sondern als ein erster Schritt zur Bewältigung eben jener Defizite, die die marktförmige Organisation bestimmter Gesellschaftsbereiche hervorbringt. Enteignung ist somit Teil eines Prozesses, der im weitesten Sinne auf Dekommodifizierung, Demokratisierung und die Überführung in öffentliches Eigentum zielt. Doch der Teufel steckt wie immer im Detail, es lohnt sich also genauer nachzuspüren, was die Gründe für Enteignungen sind (1), was nach der Enteignung kommen soll (2) und welche Herausforderungen damit verbunden sind (3).
- Auf welche Probleme sind (welche) Enteignungen eine Antwort? Nach Hans-Jürgen Urban sind Enteignungen vor allem deshalb nötig, weil „die Eigentumsordnung des Kapitalismus den Anforderungen der Menschen, der Gesellschaft und der Natur nicht gerecht wird“. Dahingehend wurden bereits viele unterschiedliche Kritiken formuliert: Die privatkapitalistische Eigentumsordnung führt zu Ausbeutung, zur Entfremdung, zu nichtlegitimierten Macht- und Herrschaftsverhältnissen. In der letzten Zeit hat sich zudem die Nachhaltigkeitskritik am Kapitalismus einen Namen gemacht. Vor dem Hintergrund dieser negativen Entwicklungen, so Urban, ist die Antwort auf die Frage, warum Enteignung zu befürworten ist, klar: „Wir wollen die Dynamik, die genau diese Defizite hervorbringt, nicht mehr haben.“ Und das heißt auch, „dass das, was nach der privatkapitalistischen Eigentumsordnung kommen soll, so verfasst sein muss, dass es keine Ausbeutung und keine Entfremdung produziert“ und dazu beiträgt, ein nachhaltiges Leben in den Bereichen Natur, Gesellschaft und Demokratie zu ermöglichen.
Ergänzend dazu warb Urban für eine „politisch-strategische Dimension“, die genau an den Punkten ansetzt, die besonders „eklatant sind“ und damit für eine breite Masse offensichtlich machen, dass „ein am privaten Profit orientiertes Wirtschaften den Erwartungen und Bedürfnissen der Menschen nicht gerecht wird.“ Jene neuralgischen Punkte seien „Gesundheit, Bildung, Kommunikation als elementares Grundrecht“. Genau in diesen Bereichen sollten also Enteignungen (zuerst) ansetzen.
Sabine Nuss brachte einen weiteren wichtigen Aspekt ins Spiel. Die simple Antwort auf die Frage, was das Ziel von Enteignungen ist, lautet: „Her mit dem schönen Leben und schönes Leben bedeutet, für alle und nicht auf Kosten der Natur.“ Dabei bestehe das Problem nicht bloß darin, dass sich vergleichsweise wenige Menschen – qua ihrer Verfügungsgewalt über die Mittel der Reproduktion – „einen Großteil des gesellschaftlich produzierten Reichtums privat aneignen“. Sondern, dass sie dies in bestimmten „Handlungsstrukturen“, nämlich unter dem „Sachzwang der Konkurrenz“, tun. Nuss zufolge verdeutlicht dieser Umstand, Änderungen der Eigentumsverhältnisse allein reichen nicht aus. Eingriffe in das Privateigentum müssen so gestaltet sein, dass sie die entsprechende Handlungsstruktur eines konkurrenzbasierten Verhaltens überwinden und Kooperation ermöglichen. Das schließe nicht zuletzt eine kooperative und rationale Planung dessen ein, was von wem und wofür produziert wird.
- Damit sind wir unmittelbar bei der Frage angelangt: Was soll auf die Enteignung folgen? Sabine Nuss und Hans-Jürgen Urban sprachen sich in der Diskussion für unterschiedliche Modelle aus. Ganz allgemein hielt Urban fest, dass vieles für eine Mischung aus verschiedenen Formen von Eigentum spreche, in der privates, staatlich-öffentliches und genossenschaftliches Eigentum koexistieren. Ganz konkret lautete Urbans Vorschlag, die dringend benötigte soziale-ökologische Transformation – eine Ebene weiter unten: in den Unternehmen – mit dem Projekt Wirtschaftsdemokratie beginnen zu lassen. Die sukzessive Ausweitung demokratisch-kollektiver Mitbestimmung im Betrieb und einer „naturverträglichen Produktions- und Konsumtionsweise“ markieren demzufolge erste Etappen in Richtung „Entprivatisierung von Wirtschaftsentscheidungen“. Nuss hingegen plädierte für ein Modell von Vergesellschaftung – und das „auf allen Ebenen“ –, wie es exemplarisch die Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen mit der Inanspruchnahme des Artikel 15 des Grundgesetzes für den Bereich Wohnen vorschlägt. Der Artikel 15 erlaubt die Änderung des Unternehmenszwecks von der Profitmaximierung zum Gemeinwohl.
Dabei meint Vergesellschaftung mehr als Verstaatlichung, sie umfasst mehr als eine Änderung der Eigentumsform und -verteilung. Für Vergesellschaftung zentral ist die Einheit aus öffentlichem Eigentum und der demokratischen Selbstverwaltung desselben. Zwei Momente leiten diese Überlegungen: Zum einen ist die Idee der Partizipation und Mitbestimmung maßgeblich. Viele Prozesse innerhalb der privatkapitalistischen Eigentumsordnung laufen anonym ab. Sie folgen der Logik des Marktes und den Dynamiken der Kapitalverwertung. Vergesellschaftung setzt hier an. Sie zielt auf die Repolitisierung sowohl der Verteilung von sozialen Gütern, die es den Individuen ermöglichen am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, als auch der Organisation von Infrastrukturen, die der Herstellung und Bewirtschaftung solcher Güter gewidmet sind. Das heißt, Vergesellschaftung ermöglicht die öffentliche Debatte und gemeinsame Entscheidungsfindung über solche Organisations- und Verteilungsfragen. Zum anderen ist die Idee einer Gemeinwirtschaft und gemeinwohlorientierten Bewirtschaftung öffentlichen Eigentums bestimmend. Gemeinwirtschaft bezeichnet eine Wirtschaftsform, die am Wohl der Allgemeinheit unter Beachtung übergeordneter gesellschaftlicher Ziele und damit primär an der Kosten- und Bedarfsdeckung orientiert ist. Vergesellschaftung bedeutet in der Konsequenz also einen Bruch mit der Logik der Profitmaximierung zugunsten einer bedürfnisorientierten Planung der Produktion.
- Die rationale Gestaltung und Demokratisierung von Wirtschaftsprozessen birgt jedoch einige Herausforderungen. Das macht die Sache nicht leichter. Gleichwohl muss ein politisches Projekt, das Vergesellschaftung im größeren gesellschaftlichen Maßstab anstrebt, darauf reagieren. Genaugenommen ist eine solche Wirtschaftsform anspruchsvoll und bietet Konfliktpotenzial, denn es gilt, verschiedene und mitunter gegeneinanderstehende Interessen und Zielsetzungen zu berücksichtigen. Beispielsweise sind demokratische Aushandlungen darüber zu führen, was unter welchen sozialen, politischen, ökologischen Bedingungen und Folgekosten produziert und konsumiert wird. Dies schließt auch grundlegende Entscheidungen darüber ein, ob bestimmte Produkte gesellschaftlich verträglich und damit aufrechtzuerhalten sind und welche Bedürfnisse als gerechtfertigt gelten. Zwei Schwierigkeiten seien im Folgenden kurz angedeutet:
- A) Es stellt sich die Frage, wer in die Entscheidungsprozesse involviert ist und wie Planungsentscheidungen auf der Grundlage von unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen ablaufen. Ein seit dem 19. Jahrhundert prominentes Konzept dafür, Wirtschaftsbelange und ‑interessen auf der Basis von Kooperation und Demokratisierung zu koordinieren, sind Genossenschaften. Dabei wäre es durchaus denkbar, dass genossenschaftliche Verbünde auch für die Zukunft ein gangbares Modell darstellen. Als grobe Faustregel für die konkrete Ausgestaltung könnte dabei gelten, dass sowohl die direkt Beteiligten als auch die indirekt Betroffenen in Entscheidungsprozesse stärker einbezogen werden und in demokratisch gewählten Gremien vertreten sind. So ließen sich Zusammenschlüsse bilden, die vor dem Hintergrund eines geteilten Problems beziehungsweise Anliegens bei ihren Entscheidungen möglichst gesamtheitlich vorgehen und diverse Zielsetzungen im Blick haben. Um dem ganzen noch etwas mehr Kontur zu geben: Genossenschaften und Entscheidungsräte würden in ihrer Größe variieren, je nach Umfang der von den Entscheidungen betroffenen Interessengruppen. Begleitet werden könnten diese Prozesse zusätzlich von transparenten Expert*innen-Komitees, die beratend zur Seite stehen und zusätzliche Optionen sondieren, über die dann gemeinschaftlich diskutiert und abgestimmt wird. Entscheidend scheint jedoch zu sein, von einer Pluralität von Verbünden – und nicht dem einen Zentralkomitee – auszugehen, die je unterschiedlich weitreichende Beschlüsse und Planungen fassen und auf unterschiedlichen Fachgebieten und Ebenen agieren. So ergäbe sich ein Netz von lokalen Zusammenschlüssen, die, sobald es der Problem- und Entscheidungsumfang verlangt, in unterschiedlichen Konstellationen zusammentreten und beraten könnten
- B) Eine andere Schwierigkeit, der sich ein stärker bedürfnisorientiertes Wirtschaften gegenübersieht, ist, dass die Rede von Bedürfnissen einer Klärung bedarf. Dabei geht es weniger um begriffliche Spitzfindigkeiten als vielmehr um den Tatbestand, dass Bedürfnisse selbst nicht einfach gegeben sind. Sie sind veränderbar und formbar, politisch umkämpft und unterliegen bestimmten Interpretationen. Angesichts der Vielfalt, Wandel- und Politisierbarkeit von Bedürfnissen stellt sich nicht nur die Frage, ob die Bedürfnisse durch wirtschaftliche Planung erfüllt werden oder eben nicht. Zu klären ist auch, wer den Bedarf ermittelt und welche Bedürfnisse als gerechtfertigt gelten, um an ihnen die Ökonomie auszurichten. In diesem Zusammenhang ist ebenso zu berücksichtigen, dass Bedürfnisse die einfache Trennung von „natürlich“ („primär“) und „gesellschaftlich“ („sekundär“) unterlaufen. Darauf hat nicht zuletzt Adorno hingewiesen und geschlussfolgert, dass dadurch erschwert sei, eine „Rangordnung von Befriedigungen aufzustellen“ (Adorno, „Thesen über Bedürfnis“).
Das lässt sich gut an einem Beispiel wie dem Wohnen veranschaulichen. Der Wunsch nach Behausung gilt vielen als eine Art von Grundbedürfnis, das zum Erhalt des menschlichen Lebens erforderlich ist. Spätestens jedoch, wenn es darum geht, über die Frage nach der Art des Wohnens zu entscheiden (die regelmäßig ein umkämpfter Gegenstand von Stadtpolitik ist), lässt sich nicht mehr eindeutig zwischen Grundbedürfnis, das allen zusteht, und „Oberflächenbedürfnis“ unterscheiden. Das verkompliziert strenggenommen auch die gängige Begründung von Vergesellschaftung zum Zwecke der Daseinsvorsorge und Sicherung von allgemeinen Reproduktionsbedingungen. Der Verweis auf (Grund)Bedürfnisse oder Grundgüter der Daseinsvorsorge, die Gegenstand von Vergesellschaftung sein sollen, bedarf der weiteren Klärung, um zu bestimmen, worum es jeweils genau geht.
Diesbezüglich weiterhelfen könnte ein Blick auf die Forderung „Recht auf die Stadt“, auf die städtische Protestbewegungen weltweit bezugnehmen. „Inhaltlich geht die Forderung auf den französischen Soziologen Henri Lefebvre zurück, der […] das ‚Recht auf die Stadt‘ als ein ‚Recht auf Nichtausschluss‘ von den Qualitäten und Leistungen der urbanisierten Gesellschaft konzipierte.“ (Holm, „Das Recht auf die Stadt“) Interessant ist hieran, dass sich die Forderung nach einem Recht auf Stadt an den immanenten Ansprüchen und Versprechungen orientiert, die mit dem Stadtleben einhergehen. Stadtpolitische Entwicklungen, aber auch Forderungen nach Vergesellschaftung etwa des Wohnraums wären so gesehen konkret daran zu messen, ob sie die internen Qualitäten der Stadt – wie etwa ein Ort der kreativen Schöpfung, der Begegnung, des kulturellen Austauschs und der Differenzerfahrung zu sein – gefährden oder befördern.
Der Vorschlag lautete also die Frage nach Bedürfnissen stärker an das Kriterium interner Ansprüche und Erwartungen, die mit bestimmten Gütern und Lebensformen verbunden sind, zu koppeln. Wie eine generellere demokratisch-rationale Planung von Wirtschaftsprozessen genau aussehen könnte, ist damit natürlich nicht ausgemacht. Es lassen sich so jedoch zumindest die Anforderungen umreißen, die an eine solche Wirtschaftsform gestellt sind: nämlich flexibel und durchlässig genug für veränderte Bedürfnisse sowie soziale Kämpfe um Bedürfnisse (Nancy Fraser) zu sein und gleichzeitig ermitteln zu können, an welchen Bedürfnissen das Produzieren und Konsumieren gerechtfertigterweise ausgerichtet ist.
- Welche Art von Transformation braucht es?
Die Frage nach Alternativen zur privatkapitalistischen Eigentumsordnung beinhaltet nicht nur eine Verständigung über die Ziele, die es zu erreichen gilt, um die zutage tretenden Probleme einer marktförmig organisierten Versorgung zu lösen. Mit ihr stellt sich auch die Frage, welche Art von Transformation nötig ist und wie der Weg dorthin gestaltet werden kann. Die Diskussion kreiste diesbezüglich um folgenden Fragekomplex: Lässt sich der Kapitalismus unterhalb des Systembruchs nachhaltig zähmen? Sind radikale Transformationen bloßen Reformen vorzuziehen und falls ja, warum? Lassen sich Reformen und radikale Transformationen verbinden? Und damit zusammenhängend: Wann stehen Reformen letzteren im Wege und wann sind sie förderlich?
Hans-Jürgen Urban bezog hier klare Stellung. Am Beginn einer breiten sozialen Bewegung, die eine umfassende Transformation anstrebt, könne nicht davon ausgegangen werden, dass Sozialismus das gemeinsame Ziel ist. Daher verbiete es sich auch, im Vorhinein alle nichtsozialistischen Positionen und Akteur*innen auszuschließen. Andererseits, und das betonte Urban gleichermaßen, habe die Geschichte oft genug gezeigt, dass Eingriffe in die Eigentumsordnung in Richtung einer Sozialbindung von Eigentum am Ende – unangetastet gebliebenen – Profitzwängen unterliegen. Es reiche nicht aus, lediglich „die Spieler auszuwechseln und die Spielregeln unverändert zu lassen.“
Vor diesem Hintergrund bleibt festzuhalten: Auch wenn Urban prinzipiell die „Gewissheit“ anzweifelte, mit der etwa ältere Konzepte der Wirtschaftsdemokratie den Sozialismus als „Endziel“ postulieren, gab er im Gespräch wiederholt zu erkennen, dass die Verbindung des Kleinen mit dem Großen nicht einfach zu kappen sei. Das Gesamtziel Sozialismus (des 21. Jahrhunderts) „als radikale Alternative zum Kapitalismus“ erscheint auch hier am Horizont – und sei es noch so klein.
Der Weg dorthin wiederum besteht aus einer Reihe von Reformen und kleinschrittigen Forderungen. Will heißen, die Schritte selbst und ihre jeweiligen Zielsetzungen können mal mehr mal weniger sozialistisch ausfallen. Urban sprach sich daher auch für eine Reihe von Maßnahmen „unterhalb des Systembruchs“ aus. So müssten Interventionsmöglichkeiten seitens des Staates zur Begrenzung der kapitalistischen Akkumulationslogik konsequent(er) verfolgt werden. Über die drei Steuerungsmedien „Geld, Recht, Normen“ ließe sich eine sozialorientierte Politik umsetzen, die ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und öffentliches Eigentum als „systemische Ziele“ berücksichtige. Eine solche Dekommodifizierung, sprich das Entkoppeln bestimmter Versorgungsleistungen vom Primat der Profitmaximierung, sieht Urban zum anderen mit dem Projekt einer „Wirtschaftsdemokratie als Mehrebenenmodell“ verbunden.
Wirtschaftsdemokratie impliziere nicht nur die Sicherung sozialstaatlicher Eingriffe, sondern ein Programm der Expansion und Intensivierung demokratischer Kontrolle als Grundprinzip der Gesellschaftsgestaltung. Dabei handelt es sich genaugenommen um ein Konzept „mittlerer Reichweite“: eine Alternative nicht zum, jedoch im Kapitalismus. In diesem Sinne würde also der kapitalistische Markt nicht abgeschafft, aber die Marktmacht – so die Hoffnung – mit Blick auf ein Primat der Politik begrenzt.
Damit stellt sich zugleich die Frage: Warum sind derartige reformpolitische Projekte grundlegenden Systemalternativen vorzuziehen? Urban hielt fest, es brauche „konkrete Utopien“, die einigermaßen deutlich erkennbar machen, wie es in Zukunft funktionieren wird, und das aus einem ganz pragmatischen Grund: dem Problem- und Zeitdruck der ökologischen Krise. „Wir haben schlicht nicht mehr die Zeit, den Kapitalismus grundlegend umzugestalten und uns zu fragen, wie eine postkapitalistische Gesellschaft aussehen soll“. Ein beschleunigter Reformismus also anstelle eines radikalen Bruchs, obgleich, und da war sich das Podium einig, das „Endziel“ jenseits der kapitalistischen Marktlogik liege.
Auch Sabine Nuss betonte dahingehend, dass reformistische Politik, „die den Leuten hilft“, durchaus zu bejahen sei. Darüber hinaus gebe es keine pauschale und abstrakte Antwort darauf, wie ein radikaler Systembruch aussieht. Es müssten die konkreten Kontexte, jeweiligen Interessen und die prägenden Handlungsstrukturen berücksichtigt und kooperativer gestaltet werden. Bei alledem sei es jedoch wichtig, zu fragen, ob Reformen ein transformatives Moment innewohnt. Urban schloss sich dem an. Eine linke Perspektive meine eben genau das, „transformative“ und nicht nur „korrektive Reformen“.
Somit hätten wir also ein Kriterium, wann Reformen hinderlich und wann förderlich sind. Mit den Worten Rahel Jaeggis: „Die entscheidende Frage ist nicht, ob Reform oder Revolution, sondern ob Reformen den Blick auf radikalere Transformationen versperren oder nicht.“
Um zum Anfang und der Verbindung des Kleinen mit dem Großen zurückzukehren: Folgt man dem Gesagten, so sind reformpolitische Projekte und kleinschrittige Forderungen nicht isoliert zu betrachten. Es gilt vielmehr, sie in den Kontext von systemischen Problemen einzuordnen, vor die eine Gesellschaft jeweils gestellt ist. Die Testfrage, die Reformen mit Blick hierauf zu bestehen haben, lautet dann, was ihr konkreter Lösungsbeitrag ist und – entscheidend – wie weitreichend sie sind. Denn eine Gefahr von Reformen besteht unter anderem darin, dass sie lediglich eine Besänftigung von Konfliktherden bewirken, wodurch die weiter glimmenden Konflikte zeitverzögert wieder aufzulodern drohen. Solche rein „korrektive“ Reformen wären also eine Bewältigung an den Krisen beziehungsweise dem Kern des Problems vorbei.
Damit Reformen nicht zu bloßen Kurzfristlösungen verkommen, sollten sie als Teil eines größeren Transformations- und Lösungsprozesses angelegt sein. Als solche Teile eines übergreifenden Emanzipationsprozesses verzeichnen „transformative“ Reformen einen gewissen Überschuss. Sie treiben über sich hinaus und initiieren Anschlussforderungen und -kämpfe. Die Verbindung des Kleinem mit dem Großen wirkt zugleich auch in die andere Richtung. Nicht nur beeinflusst die auf ein längerfristiges Ziel gerichtete Perspektive aktuelle Reformschritte, auch das (vage) Ziel, das am Ende des Prozesses steht, bleibt vom Prozess selbst nicht unberührt. Es kann sich unterwegs ändern und muss auch anhand von im Verlauf auftauchenden Problemen, konkreten Teilkämpfen und Teilreformen neujustiert und auf die Probe gestellt werden.
Es ist also gerade die Verbindung des Kleinen mit dem Großen, an der es sich aus Sicht einer umfassenderen Transformationsperspektive festzuhalten lohnt. Das wiederum legt jedoch nahe, „große Ziele“, die über die „mittlere Reichweite“ und ein Fahren auf Sicht hinaus – auf alternative Gesellschaftsmodelle – weisen, nicht im Vorhinein über Bord zu werfen. Urbans oben zitierte Bemerkung lässt sich folglich auch umdrehen. Gerade unter Zeit- und Problemdruck – wann, wenn nicht dann – ist (auch) die Frage zu stellen, wie sich der Kapitalismus (zum Zwecke der Lösung seiner systemischen Probleme) grundlegend umgestalten beziehungsweise überwinden lässt.
Ein Grund dafür ist nicht zuletzt in dem zu sehen, was Alex Demirović am Ende der Diskussion zu bedenken gab, dass uns nämlich die sozial-ökologische Krise mit ihrem spezifischen Zeithorizont vor eine ganz besondere Herausforderung stellt. Sie konterkariert unsere bisherigen politischen Denk- und Handlungsweisen, die stets mit einer „Umkehrbarkeit der Verhältnisse“ rechneten. Die Dringlichkeit der Klimakrise scheint nämlich einen anderen Typ von Lösungen zu verlangen, der kein zwischenzeitiges und schrittweises Zurück oder auch nur Vertagen duldet. Demirović betonte daher auch, „wir müssen uns fragen, wo ist der Punkt, an dem wir Unumkehrbarkeiten und Sperrklinkeneffekte gesellschaftlich herstellen“ und sichern können. Und genau für solche Sperren könnte, so Demirović, ein sozialistisches Gesellschaftsprojekt einstehen.
Was hier mitschwingt, ist ein grundsätzlicher Zweifel an der Nachhaltigkeit „kapitalistischer“ Krisenbewältigung, die, betrachtet man die historische Dynamik von sozialstaatlicher „Einbettung“ und stärkerer Marktorientierung durch die Linse Karl Polanyis, grundlegend auf dem Prinzip einer Umkehrbarkeit von getroffenen Reformen, Entscheidungen und Lösungen beruht. Zumindest dieser Blick in die Geschichte sozialer Einhegungen (von Eigentum) und Entfesselungen der Marktkräfte legt die Vermutung nahe, dass bisher und angesichts des aktuellen Problemdrucks noch zu viele „transformative“ Reformen blockiert wurden und werden.